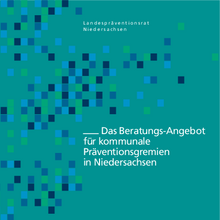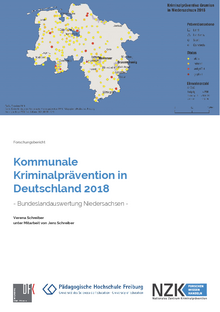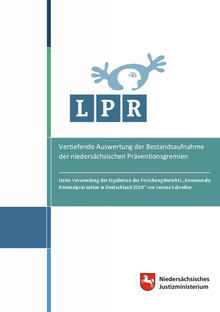Die kommunalen Präventionsräte stellen das Rückgrat für die gesamtgesellschaftliche Prävention in unserem Bundesland dar. In Niedersachsen bestehen rund 200 kommunale Präventionsgremien, die Mitglied im Landespräventionsrat sind.
In diesen Gremien arbeiten unterschiedliche Akteur*innen zusammen und stimmen sich miteinander ab, z.B. aus der Jugendarbeit, Kitas, Schulen, Kommunalverwaltung und -politik, Vereine, Polizei und Justiz.
Neben der hauptamtlichen Arbeit ist das ehrenamtliche Engagement eine wichtige Säule der kommunalen Präventionsarbeit.
Die wertvolle Arbeit der kommunalen Gremien auch in Zukunft sicherzustellen, ist eine wichtige Zielstellung im Landespräventionsrat.
Die Geschäftsstelle des LPR unterstützt die Arbeit in den kommunalen Präventionsgremien durch verschiedene Angebote, die wir hier näher vorstellen.